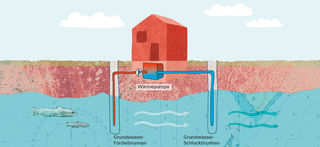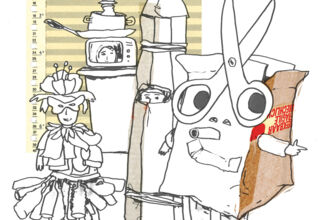Nachhaltigkeit
Mut zur Unordentlichkeit

Eine solch vielfältige Blumenwiese gefällt auch der Katze besser: Frühlingsspaziergang durch die abl-Siedlung Mittlerhus in Kriens.
Roland Lang sorgt bei der abl dafür, dass in den Quartieren mehr Biodiversität herrscht. Dabei können die Bewohnerinnen und Bewohner lernen, dass man im Garten auch mal etwas faul sein darf: zum Wohl der Bienen, Hummeln, Vögel und Eidechsen.
Nein, dieser Rasen mitten im Weinbergli-Quartier sieht nicht so aus, als ob auf ihm Golf gespielt werden könnte. Das Gras ist lang, gelbe und violette Primeln spriessen, an einigen Stellen wächst gar Löwenzahn. Freunde des gepflegten englischen Grüns würden hier wohl gerne gleich mit dem Rasenmäher drüberwollen. «Das ist ein wunderschöner Rasen», kommentiert Roland Lang, Fachbereichsleiter Gartenunterhalt bei der abl, den Wildwuchs. «Genauso muss das sein.»
Lang ist dafür zuständig, dass in den abl-Quartieren mehr Biodiversität herrscht. An diesem Morgen zeigt er Orte, die schon auf gutem Weg sind, damit die Natur auch mitten in Wohnquartieren wieder vielfältiger werden kann. «Biodiversität heisst für mich Toleranz der Unordentlichkeit», sagt Lang. Und unordentlich ist der Rasen im Weinbergli-Quartier nur für die Bewohnerinnen und Bewohner, die alles gerne akkurat gestutzt haben wollen. «Die Natur benötigt verschiedene Pflanzen, Sträucher und Bäume. Sie dienen den Bienen, Hummeln, Vögeln und Eidechsen als Lebensorte.» Auch beim Zierapfelbaum, der am Hang neben dem Rasen steht, können sich Bienen und Hummeln an den Blüten bedienen. Trotzdem ist er laut Lang nicht die perfekte Wahl. «Ich hätte hier einen normalen einheimischen Apfelbaum gepflanzt. Der ist auch für die Insekten gut, versorgt aber auch die Vögel und vor allem den Menschen mit Äpfeln.» Das schaffe bei der Bevölkerung wiederum Sensibilität für das Thema. «Die Eltern können den Kindern den natürlichen Kreislauf von der Blüte bis zur Frucht vor der eigenen Haustüre zeigen und erklären.»


Den Blick schärfen und Geduld haben
Eine solche Aufklärung sei nicht nur für die Kinder wichtig. Auch Lang leistet viel Informationsarbeit. «Man muss die Bevölkerung einbeziehen. Ihr erklären, warum auf einmal zwischen dem Gras der Löwenzahn, übrigens eine Heilpflanze, wächst und das in Ordnung ist. «Manche kommen zu mir und sagen, dass man jetzt zwanzig Jahre lang immer alles herausgeputzt habe. Und ich sage dann: ‹Ja, und ab jetzt machen wir es anders.›»
abl setzt auf Nachhaltigkeit
Die Förderung der Biodiversität ist nur ein Bereich, bei dem die abl auf Nachhaltigkeit setzt. «Wir haben uns schon vor Jahren mit dem Thema befasst und geschaut, wie wir nachhaltiger werden können», sagt Roland Gasser, Leiter Technische Bewirtschaftung der abl. So würden, wenn möglich, bei Bestellungen lokale Lieferanten berücksichtigt oder möglichst energieeffiziente Gerätschaften angeschafft. Aktuell arbeite man zum Beispiel an einem intelligenten Beleuchtungskonzept. «In einer Tiefgarage wird nur gerade die Stelle beleuchtet, an der ich mich befinde», sagt Gasser. Bei der Biodiversität selbst sei das langfristige Ziel, alle Bäume, Sträucher und sonstige Gewächse durch einheimische Pflanzen zu ersetzen. «Das wird aber sicher noch ein langer Weg sein», sagt Gasser. Damit die abl nachhaltiger sein kann, braucht es laut Gasser insbesondere die Mithilfe der Mieterinnen und Mieter. «Das Verständnis der Bewohnerinnen und Bewohner ist sehr wichtig. Deshalb suchen wir das Gespräch mit ihnen und versuchen, sie zu sensibilisieren.» bat
Lang selbst hat einen engen Bezug zur Natur. Aufgewachsen auf dem Land, habe er seine Kindheit und Jugend im Wald und auf Wiesen verbracht. «Wir haben keinen Spielplatz gebraucht, sondern eine gute Waschmaschine. Wir waren immer dreckig.» Er und seine Geschwister seien fast nie hungrig aus dem Wald gekommen. Auch heute noch könne er sich bei einer Joggingrunde im Wald von der Natur verköstigen. «Sie bietet so viel: Buchennüsse, wilde Beeren, man muss sie nur kennen.»
Für mehr Biodiversität in den Quartieren braucht es nicht nur Mut zur Unordentlichkeit, sondern auch viel Geduld. «Bis man eine schöne Blumenwiese auf einem Rasen sieht, vergehen acht Jahre», weiss Lang. Besonders die ersten Jahre falle es den Leuten schwer, das in ihren Augen wuchernde Gras zu akzeptieren. «Sie sehen anfangs keine Blumen, nach drei bis vier Jahren, vielleicht vier bis fünf, und fragen mich dann, ob es für diese Blümchen das alles wert gewesen sei.» Was sie aber nicht sehen würden, seien die Hunderte von Blumen im Rasen drin, die zwar da sind, aber sich zuerst entwickeln müssen.

Roland Lang, abl-Gartenspezialist: «Ich wünsche mir, dass wir sorgsamer mit der Natur umgehen.»
Neophyten gehören beseitigt
Um die Menschen an den wilden Rasen zu gewöhnen, wendet Lang die Salamitaktik an. Zuerst werde der Rasen noch siebenmal pro Jahr gemäht, dann noch vier, dann noch zwei und so weiter. «Die Leute gewöhnen sich so langsam an ihn, ohne dass das Gras gleich zu Beginn sehr hoch wird.»
Freude hat der Gärtner auch an wuchernden Gärten. Etwas weiter zeigt Lang einen solchen. Neben Salatköpfen wachsen Blumen im Beet, besonders schön anzusehen ist der blühende Federkohl. «Auch im Schrebergarten darf es wild sein», sagt Lang. Für den, der trotzdem das Unkraut bekämpfen will, sein Tipp: «Ich würde es einfach umjäten und dann liegen lassen. Es vertrocknet an der Oberfläche, der Salat wächst sowieso darüber und man bekommt wieder neuen Humus.»Auch wenn Lang dafür plädiert, möglichst viele Pflanzen stehen zu lassen, müssen manche unbedingt ausgerissen und entsorgt werden. Welche er meint, zeigt er an einem Hang in der Nähe des Waldrandes im Weinbergli-Quartier. Dort stand ein meterhoher Kirschlorbeer. Das Problem: Der Kirschlorbeer ist ein sogenannter Neophyt. Diese Pflanzen sind hier nicht heimisch, vermehren sich schnell und verdrängen die einheimischen Pflanzen. Die Bekämpfung solcher Neophyten ist aufwendig und vor allem kostspielig. Denn sie müssen tief mit der Wurzel ausgegraben und dann speziell entsorgt werden. Trotz des grossen Aufwands müsse auch diese Arbeit geleistet werden, um die heimische Artenvielfalt zu erhalten.



Auch Mauerblümchen sind zugunsten der Fauna erwünscht, Hecken, Büsche und Blühendes wie hier der Federkohl sowieso.
Schatten lieber unter Bäumen
Dass der Anspruch, Biodiversität und Wohnqualität unter einen Hut zu bringen, nicht immer einfach zu erfüllen ist, zeigt sich in einem anderen Quartier. Dort steht ein etwa zehn Meter hoher Ahornbaum gleich neben einem Mehrfamilienhaus. An ihm hat Lang zwei Vogelhäuschen befestigt, in dem Vögel brüten könnten. «Wir müssen schauen, ob die Vögel die Kästen annehmen. Ansonsten werden wir sie neu ausrichten müssen.» Nicht alle Bewohnenden finden den Baum toll, denn er wirft im Sommer Schatten auf die Balkone. Den Baum deswegen zu beschneiden oder gar umzusägen kommt nicht infrage.Sowieso, wer es an heissen Sommertagen lieber kühl hat, der sei unter einem Baum viel besser aufgehoben als unter einem Sonnenschirm, weiss Lang. «Der Baum verdunstet über die Blätter Feuchtigkeit, das kühlt die Umgebung.» Ausserdem könne der frische Wind zwischen den Blättern hindurchwehen.
Wir sind hier nur Gäste
Wer mit Lang unterwegs ist, der bekommt einen anderen Blick auf die Umgebung im Quartier. Einen schärferen. Plötzlich ist alles grün, Gräser, Bäume, Sträucher, Blumen, die man vorher kaum wahrgenommen hat, sind auf einmal sehr präsent.Und wer diese Zeilen liest, wird bald feststellen, wie grün die Stadt doch eigentlich ist – würde man sich nur mehr achten. «Ich wünsche mir, dass wir sorgsamer mit der Natur umgehen», sagt Lang. «Wir sind nur Gast hier. Wir kommen auf die Erde, verändern sie und gehen dann wieder.» Aber die Natur bleibe.